Mike Vogl
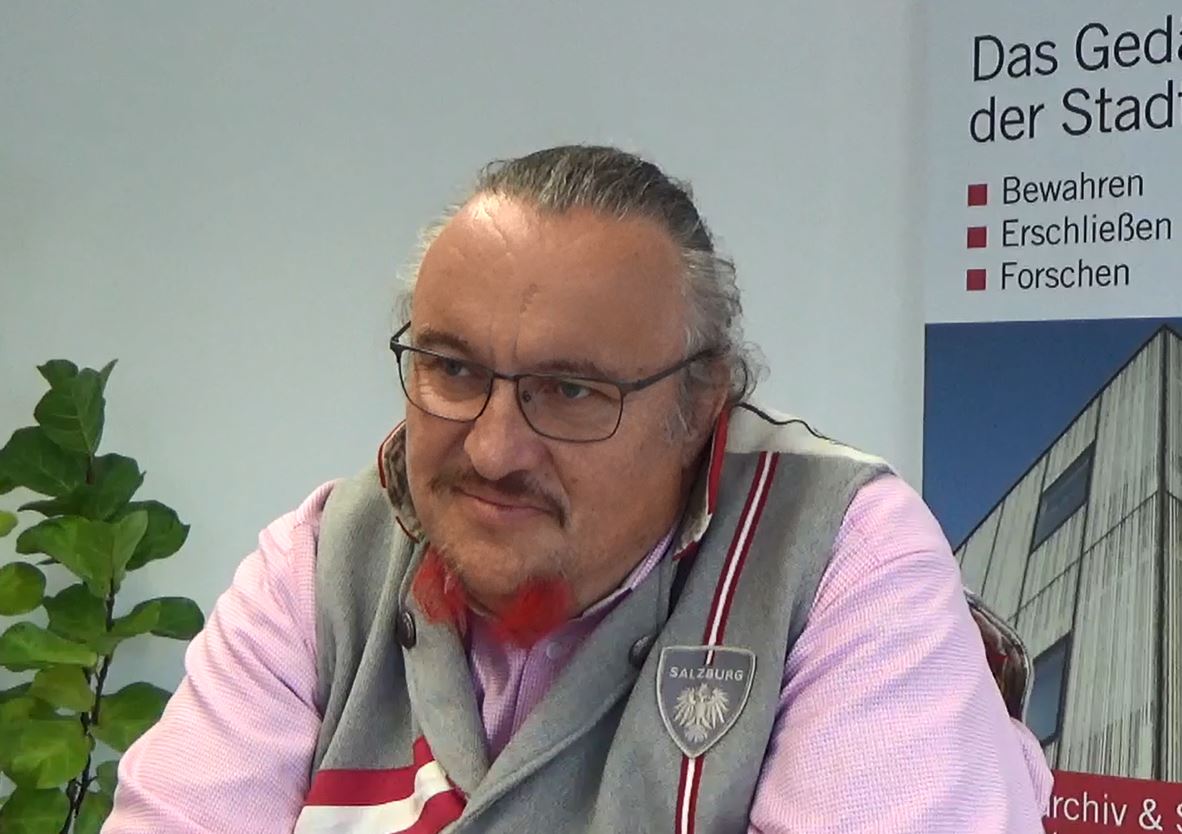
Interview mit Mag. Mike Vogl
im Rahmen des Buchprojekts „Die große Flucht“
Pressefotograf, im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 am Grenzübergang sowie am Hauptbahnhof und in der ehemaligen Autobahnmeisterei als Fotograf und auch als freiwilliger Helfer tätig
Datum: 28. Mai 2019
Ort: Stadtarchiv Salzburg
Dauer: 00h 40min 13sec (1 Track)
Interviewer: Dr. Heinz Schaden
HS = Heinz Schaden (Interviewer)
MV = Mike Vogl
TRANSKRIPT DES INTERVIEWS
[Ergänzungen in eckigen Klammern wurden bei der Transkription vorgenommen und dienen dem besseren Verständnis.]
HS: Was mich bei dir besonders interessiert: Ich war bass erstaunt, dich an der Grenze zu finden. Weil ich habe dich ja vorher nur als der Mike Vogl, der Fotograf, Teil der journalistischen Szene, kennen gelernt – ich brauche dich dir nicht zu beschreiben. Und [ich] war dann wirklich überrascht, und mein ganzes Bild von dir hat sich ziemlich massiv verändert, wie du mir dann erzählt hast, dass du dir Urlaub genommen hast. Also ich bitte dich, dass du auf das vielleicht nicht gleich, aber dann im Laufe der Geschichte eingehst und auch ein bisschen diese Doppelrolle, die du da gehabt hast – Zivilgesellschaft und jemand, der das Ganze dokumentiert – also Journalist ist nicht das exakte Wort, du bist ja kein Chronist gewesen. Dann fangen ich vielleicht einmal an – also, aus deiner Sicht: Warum ist es zu dieser ‚neuzeitlichen Völkerwanderung’ gekommen und wie war damals die Stimmung?
MV: Ich glaube, dass – und das habe ich auch in Gesprächen mitbekommen – dass die Menschen, die da über der Grenze gekommen sind, geglaubt haben, sie kommen ins Schlaraffenland. Dort sind einfach Fehlinformationen geflossen, in den anderen Ländern, wo die geglaubt haben, du kommst nach Deutschland und bekommst ein Haus, bekommst Geld, bekommst Arbeit. Und dass es nicht so war, sind sie dann erst drauf gekommen, wie sie schon in Deutschland waren. Also das ist für mich, glaube ich, der Grund, warum die Menschen hergekommen sind und geglaubt haben, dort geht es ihnen besser. Mich hat es immer ein bisschen an den Goldrausch erinnert. Da haben auch alle geglaubt „Da marschieren wir jetzt hin, finden Gold und werden reich“ – wie man weiß, es war nicht so, es sind nur ein paar reich geworden.
HS: Der Krieg in Syrien, der Krieg – oder die Kriege im Nahen Osten – zum Schluss sind ja dann auch viele Leute aus Marokko gekommen, wo eigentlich kein Krieg war, oder schon lange keiner mehr – hat das aus deiner Sicht eine Rolle gespielt, ich meine für die unmittelbare Fluchtbewegung?
MV: Sicherlich hat das eine Rolle gespielt. Wenn es dir daheim schlecht geht, und du glaubst, dass es dir woanders besser gehen kann, dann liegt es nahe, dass du dir überlegst, dort hin zu gehen, wo es dir besser geht. Und wenn deine Häuser zerbombt sind und die Familie in Gefahr ist, dann, glaube ich, ist jeder Mensch so, dass er sagt „Ok, ich überlege mir wirklich, ob ich nicht woanders hingehe, weil bei uns ist die Lage zu instabil“. Nicht nur für denjenigen selber, sondern auch für die Familie.
HS: Ok – machst du da einen Unterschied zwischen Kriegs- und den so genannten Wirtschaftsflüchtlingen?
MV: Absolut. Absolut, da gibt es für mich einen riesigen Unterschied. Die Menschen, die aufgrund des Krieges geflohen sind, aus Angst um ihr Leben, um ihren Leib, die haben weg müssen. Die Wirtschaftsflüchtlinge haben einfach nur geschaut, dass es ihnen irgendwo besser geht, finanziell, wirtschaftlich, darum auch ‚Wirtschaftsflüchtling’. Die anderen, die vom Krieg, die haben wirklich geschaut – also die Leute, die aus Syrien gekommen sind – man hat ja genau die Unterschiede auch gemerkt – die angekommen sind, da sind Leute gekommen mit einem Plastiksack, und da war ein zweites Paar Schuhe drinnen und ein bisschen etwas zum Trinken, und sonst haben sie nichts gehabt, außer das, was sie am Leib gehabt haben. Und dann, sage ich einmal, Wirtschaftsflüchtlinge, da spreche ich hauptsächlich die Nordafrikaner an, und auch die Westafrikaner, die sind dann schon anders gekommen, auch dahergekommen, das hast du auf den ersten Blick gleich einmal gemerkt, wo kommt der her. Da hat er noch gar nichts sagen müssen oder so – du hast ihn angeschaut, wenn die ins Camp gekommen sind und sich angemeldet haben, [und] hast gewusst „Ok, der kommt irgendwo aus dem Kriegsgebiet und der kommt irgendwo aus einem Land, wo er einfach in Europa eine bessere wirtschaftliche Situation erwartet“.
HS: Jetzt zurückgedacht, wann hast du die ersten Anzeichen wahrgenommen, dass sich da was zusammenbraut?
MV: Relativ spät. Ich vermute, es war das Frühjahr 2015. Aber da auch nur medial, aus Italien, aus den Geschichten, dass da Leute ankommen, Ende 2014 – wirklich „Da passiert jetzt was“ habe ich dann gemerkt, wie sie die Zelte gebaut haben, bei mir in der nächsten Nähe bei der Polizeidirektion in der Alpenstraße und wie da auf einmal angefangen wurde, Zelte für Flüchtlinge zu bauen, das war so für mich das Erste, wo ich mir gedacht habe „Aha, jetzt kommen sie bis zu uns herauf, jetzt sind sie bei uns auch da. Also nicht nur in Italien, sondern jetzt sind sie da“. Dann war es aber, ich sage einmal aktuell – ich sehe es immer ein bisschen von der Berichterstattung – nicht so schlimm, bis eben dann im Sommer, August 2015 dann die Welle über Österreich hereinbrach.
HS: Ja, es war, glaube ich, in Salzburg am Hauptbahnhof die Nacht vom letzten Augusttag auf den ersten Septembertag
MV: Genau, das war so für mich der Beginn.
HS: Und, wie du richtig gesagt hast, vorher das Zeltlager und [das Hotel] Kobenzl, interessanterweise, als Verteilzentrum.
MV: Genau. Das Hotel Kobenzl auch, das sie ja schon früher angemietet haben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da oben war, fotografieren, da durftest du nicht hin, das hat man nur von außen fotografieren dürfen, obwohl noch gar keine Flüchtlinge da waren [lacht].
HS: Genau. Jetzt komme ich zu dem Part, der dich auch selber ein bisschen beleuchten soll: Wie bist du zur Grenze gekommen, oder warst du vorher noch woanders – weil ich habe dich erst direkt an der Grenze getroffen. Was hat dich da bewegt, was hat dich motiviert?
MV: Ich war vorher im Bereich Bahnhof, eben als Fotograf und Reporter, und dann rufen mich Leute an, Bekannte von mir, die sagen „Du Mike, an der Grenze draußen geht es auch ganz schön zu“. [Da] habe [ich] mir gedacht „Ja, ok, schaust du einmal da raus und berichtest einmal von dort, was sich dort tut“. Und da sehe ich Leute, die da kommen, mit Einkaufswagen, mit Autos, die da Zeug daherbringen, Essen, und auf dem Boden waren ein paar Leute, die herumgesessen sind – und viele Leute, die helfen wollten. Das ist so weit gegangen, vom Primar-Arzt mit seiner Frau, die den Kofferraum aufmacht, die Tochter war auch dabei, und große Töpfe mit heißer Suppe, die sie gemacht haben, dort verteilt. Und da hat es bei mir schon angefangen, [ich] habe mir gedacht „Hoppala, da ist eigentlich niemand, der hilft. Wir haben den Bahnhof, da sind die ganzen Einsatzorganisationen, aber da draußen ist niemand“. Und dann habe ich da draußen fotografiert, und dann hat es für mich, ich sage dieses einschneidende Erlebnis gegeben, wo ich gesehen habe, dass eine Mutter mit einem Kleinkind – es war zwar nicht kalt, aber es war auch nicht warm, also für ein Kleinkind war es auf jeden Fall kalt, so muss man schon sagen – die dort auf dem Boden gelegen sind, das Kind ist auf dem Boden gelegen und sie hat es so zur Hälfte mit ihrem Mantel abgedeckt oder mit ihrer Jacke. Und da habe ich mir gedacht „Irgendwas muss da jetzt passieren“. Und die Leute wollten nicht mehr weggehen. Die haben gewusst, „Da ist die Grenze und da gehen wir nicht weg. Da geht es zu“ – wie sie immer gesagt haben – „Mama Merkel“. Da geht es in ihr Paradies, in ihr Schlaraffenland. Und die sind nicht mehr weg gegangen.
HS: Haben die wortwörtlich „Mama Merkel“ gesagt?
MV: Die haben wortwörtlich „Mama Merkel“ gesagt. Das war so, das war – wir haben dann, ich glaube es war Mitte September, eine Dame gehabt, die war hochschwanger und die hätte eigentlich in Salzburg entbinden sollen, das wollte sie nicht, die wollte haben, dass das Kind in Deutschland entbunden wird, weil, wenn es ein Mädchen wird, heißt es Angela. Da haben wir uns gedacht „Ok“, und wir haben die dann auch, hochschwanger, drüben hat schon das Rote Kreuz von Deutschland gewartet, das Bayerische Rote Kreuz, die ist dann dort [angekommen] und hat dann drüben auch – das habe ich dann nicht mehr mitbekommen – aber sicherlich drüben entbunden.
HS: [Das] war natürlich auch für die, für das Asylverfahren wahrscheinlich ein Vorteil.
MV: Vermutlich, wenn du das Kind dort drüben auf die Welt bringst. Aber sie hat gesagt, sie will zuerst nach Deutschland.
HS: Jetzt aber trotzdem, ich meine, du beschreibst dieses Bild, von dem Kind und der Mutter – was hat dich dann so motiviert – du hast Urlaub genommen, hast du mir erzählt.
MV: Ja, und meine ganzen Freistunden.
HS: Das ist ja ganz etwas Ungewöhnliches, eigentlich.
MV: Ja, es ist einfach nicht anders, es hat nicht anders funktioniert, es ist nicht anders gegangen. Ich bin dort dann reingefallen in das Ganze. Die Leute waren dort, haben Sachen verteilt, und es war eigentlich ein totales Chaos. Weil jeder ist gekommen und hat irgendwas gebracht und wollte irgendwie helfen. Aber es war Null Struktur drinnen. Und ich habe dann ein bisschen mit dem Sami, der auch von Anfang an dabei war, mit dem Daniel und mit der Susanne eben ein bisschen eine Struktur da hineingebracht in das Ganze – und irgendwann war das dann so, da haben sie gefragt, wenn sie etwas gebracht haben „Ja, was tun wir damit?“ – „Ja, frag den Mike. Frag den Mike oder frag den Sami, frag die – die wissen Bescheid“. Und dann haben wir geschaut, dass wir das Ganze in Bahnen lenken, dass das funktioniert. Wir haben Suppen gehabt, aber zu wenige Becher, dass wir die Suppen ausgeben können. Ja, ok, dann fährst du halt einmal dort hin, wo du jemanden kennst, rufst dort an, dass du irgendwelche Sachen bekommst...
HS: McDonalds…
MV: McDonalds, dass du diese Becher bekommst. Weil das war ja egal, die haben ja nur die Suppe, etwas zum Essen gebraucht, das haben sie aus einem Becher essen können. Und da war – ja, und das hat so eine Eigendynamik entwickelt. Und irgendwann stehst du mitten drinnen, und jeder braucht irgendetwas und fragt dich, und ich habe einen Vorteil gehabt, ich habe berufsbedingt viele Leute von Einsatzorganisationen und von der Politik gekannt und die haben dann gefragt „Du, wie schaut’s aus“ und dann habe ich gesagt „Ja, ok, so was wäre gut, das“ – und auf einmal war dann Stadt, Land, Feuerwehr, Polizei, Samariterbund, Rotes Kreuz, alle, war ein Einsatzstab beisammen und dann war das organisiert auf einmal. Und das hat mich ziemlich fasziniert, weil ich habe mir gedacht „Na super, jetzt haben wir das beisammen, Stadt, Land, wenn wir da jetzt einen Bleistift brauchen, müssen wir 15 Anträge schreiben mit drei Blaupausen, dass wir da irgendwas kriegen“. Und da habe ich mich echt getäuscht. Da habe ich mich wirklich getäuscht, weil ich habe mir gedacht „Das gibt’s nicht – auf einmal funktioniert das“. Das ist alles den kurzen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir brauchen da Mülltonnen. Am nächsten Tag stehen da Mülltonnen. Da kommen Leute zum Zusammenräumen daher auf einmal, vom Magistrat – wie jetzt, wie geht das, dass das auf einmal auf kürzestem Wege geht? Die haben alles gemacht, dass das funktioniert, das war für mich so faszinierend. Wir haben kein Licht gehabt, das war alles finster. Auf einmal kommt da jemand vom Beleuchtungsamt, und die bauen das dort auf und das funktioniert, reparieren alte Beleuchtungskörper – das war, also ich habe mir wirklich gedacht „Hoppala, im Krisenfall, auf einmal geht das alles einen direkten Weg und es funktioniert perfekt“. Und es haben alle an einem Strang gezogen, das war das Schöne. Und sie sind auch uns Freiwilligen, mit unserer, wir haben es genannt ‚Helferz’ – unsere ‚Helfer mit Herz’-Organisation, die eigentlich keine Organisation war, sondern nur ein wilder Zusammenschluss von Leuten, die eigentlich gerne helfen wollten, das waren aber am Schluss eineinhalb Tausend, oder 1.800 Leute, die wir da registriert hatten – die haben uns auch auf Augenhöhe begegnet, und nicht gesagt, irgendwie „Das sind jetzt so die Freiwilligen, ja“, sondern, wenn wir etwas gebraucht haben, haben wir das bekommen, man hat es argumentiert, warum ist das wichtig, und es hat funktioniert. Und das war wirklich für mich so eine Erfahrung auch, wo ich gesagt habe „Hey, es geht. Es geht wirklich. Wenn die Not da ist, dann arbeiten alle super zusammen“. Und das ist für mich sicherlich eines der schönsten, eine der schönsten Erinnerungen, die ich daran habe.
HS: Jetzt verrate ich dir etwas: Als wir zur Grenze gekommen sind – ‚wir’ sage ich jetzt, Magistrat, im weiteren Sinn des Wortes – warst du ja schon da, und das hat ja schon funktioniert. Und, also ich kann zumindest meine erste Reaktion wiedergeben, ich habe gesagt „Vorsicht, das ist der Mike Vogl, der hat da eine Organisation aufgebaut, mit dem müssen wir jetzt vernünftig umgehen, weil sonst schmeißt er uns hin“ [lacht]. Also einen gewissen Respekt hast du dir offensichtlich erarbeitet.
MV: Ich weiß, es war auch von manchen Teilnehmern oder Institutionen die Angst, „Der ist in der Medienbranche, der ist Journalist, wie können wir dem jetzt trauen?“ Ich war ja doch bei den ganzen Sitzungen dabei, bei den Einsatzbesprechungen, und es war immer wieder die Frage „Ja, wenn wir das heute da besprechen, weiß das morgen die Zeitung oder das Fernsehen?“ Und ich habe dann immer gesagt, sage ich, „Ich bin privat da, ich bin eine Privatperson“, sage ich. „Ich kann meinen Job komplett trennen von dem, was ich privat mache“, sage ich. „Was ich da sehe und da höre, verlässt diesen Raum nicht. Aus“. Und das war für mich auch das Wichtigste – das war am Anfang für viele ein Problem, das weiß ich auch, aber mit der Zeit haben sie dann gemerkt, „Hoppala, man kann ihm doch trauen. Dem geht es um die Sache und nicht darum, dass er irgendwelche Schlagzeilen hat oder gute Geschichten macht“. Und das war für mich auch wichtig, dass man gesehen hat, es wird ein Vertrauen aufgebaut. Und es ist nur mit Vertrauen gegangen. Die ganze Aktion hat etwas mit Vertrauen zu tun gehabt, weil man hat sich auf die anderen verlassen müssen.
HS: Darf ich noch einmal nachfragen: Was war in dir, oder was ist in dir gesteckt, dass du in der Situation angesprungen bist, sozusagen, also dass du – das Bild von dem Kind auf dem Boden, das hast du mir gerade erzählt, aber was hast du von deiner persönlichen Vergangenheit mitgebracht zu diesem Moment, wo du das gesehen hast. Wo gibt es bei dir so eine innere Bereitschaft, oder wo kommt die her?
MV: Es ist die innere Bereitschaft, glaube ich, zu helfen. Ich habe das schon immer gehabt. Egal wo, in der Schule, ich war Freiwilliger beim Roten Kreuz, ich habe Spendenaktionen gestartet in meinen jungen Jahren für irgendwelche Sachen. Für die Lebenshilfe haben wir Perchtenläufe gemacht, ich habe gespendet, für, wie ich dann im Berufsleben war, Sattelzüge mit Brennholz für bosnische Flüchtlinge, wir haben ‚Bauern helfen Bauern’ unterstützt. Das ist einfach eine Geschichte, ich sage, wenn es uns gut geht – es ist zwar eine abgedroschene Floskel – aber wenn es uns gut geht, ist das super, nur, wir sollten auch schauen, dass es den anderen gut geht und wir können es uns leisten, dass wir da einmal helfen. Und – ich sage, ich konnte kein Geld investieren, ich konnte Zeit investieren. Und Zeit war für mich damals sicherlich noch wertvoller als Geld, und man hat dort Manpower gebraucht. Und die konnte ich zur Verfügung stellen. Ich habe gewusst, ich kann das Team mitführen – wir waren mehr oder minder ein, so ein, in unserer Organisation von den Freiwilligen waren wir so eine Organisationsgruppe mit 5-6 Leuten, und wenn es Probleme gegeben hat, haben wir das da besprochen und haben dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Und ich habe einfach gewusst, ok, wie führt man das, man kann nicht nur nett sein, man muss das auch durchsetzen, dass Sachen funktionieren, dass es so funktioniert, dass es für alle gut ist. Weil am Anfang haben wir Kleiderspenden dort gehabt, wir hätten, glaube ich, alle Salzburger, Land- und Stadtschulen, mit Kleidern ausstatten können, nur, die Leute haben alles daher gebracht. Es ist soweit gegangen, mit Säcken mit Eislaufschuhen und Bikinis. Ja, wo ich dann gesagt habe „Stopp einmal, wir schauen uns das am Anfang durch“ – das hat dann komplett alles gleich von Anfang an eh die Caritas übernommen, und wir haben dann die Kleider zum Beispiel von der Caritas bekommen – aber da habe ich mir gedacht, teilweise haben die Leute, die dieses Zeug gebracht haben, glaube ich, daheim einfach ihren Müll ausgemistet. Es hat welche gegeben, die haben gesagt „Was braucht ihr?“, aber wie gesagt, wir fanden Eislaufschuhe. Und Bikinis.
HS: Wo hat es Konflikte gegeben? In deinem Umfeld, mit den Behörden, mit den anderen Helfern...
MV: Konflikte hat es gegeben im – mit Helfern hat es sicherlich auch Konflikte gegeben, wo wir einfach gesagt haben „Wir gehen das so an“, und die wollten das anders machen. Wir haben dann versucht, zu argumentieren, warum wir das so machen wollen. Viele haben es, oder die meisten haben es dann eingesehen, warum – da ging es um Öffnungszeiten für [die] Kleiderkammer etc. – andere nicht, die haben dann ihren eigenen Weg beschritten, das war dann so, dass wir das Bundesheer gebraucht haben, dass sie die Kleiderkammer sichern, weil die Leute da einfach hineingerannt sind und sich genommen haben, was sie wollten. Und es hat nachher ausgeschaut, ja, wie nach einem Bombenabwurf. Und da habe ich dann gesagt „So nicht. Wir haben das von Anfang an gesagt, es gibt gewisse Zeiten, mit gewissen Leuten, die dort unten stehen, nicht nur eine Person, die da die Tür aufsperrt und alle rennen hinein“, und da haben dann auch ein paar Leute aufgehört oder wollten einfach nicht mehr, weil es einfach diese Regelung gegeben hat. Ich habe mich…, wir konnten uns da nicht auf jedes Einzelschicksal konzentrieren. Wir haben echt geschaut, wenn wir ein Kind gesehen haben, das barfuß gegangen ist, dann ist halt einer einmal schnell heimlich in die Kleiderkammer gegangen und hat geschaut, dass dieses Kind Schuhe hat. Nur, dass wir sagen „Es sind jetzt so viele Kinder gekommen, wir können dies und das nicht machen, weil es einfach von den Ressourcen her nicht geht“, an das haben wir uns halten müssen. Es hat Pläne und Zeitpläne gegeben, an die wir uns gehalten haben, wann gewisse Sachen gemacht werden, und, wie gesagt – Einzelschicksale, wenn es möglich war, haben wir darauf geschaut, nur, wir konnten nicht auf jedes Einzelschicksal Rücksicht nehmen, bei der Menge an Menschen, die da über die Grenze gekommen sind.
HS: Hat es unter den Flüchtenden Konflikte gegeben, die du wahrgenommen hast?
MV: Ja, natürlich hat es die gegeben. Hauptsächlich – am Anfang, sage ich einmal, wo viele Kriegsflüchtlinge dabei waren, weniger. Da hat es nur kleine Differenzen gegeben, wann sie über die Grenze wollten, aber das haben wir relativ gut unter Kontrolle gehabt, eben dank des Bundesheeres auch, und dank der Exekutive, die da geschaut haben, dass man solche Sachen gleich einmal im Keim erstickt. Es gab Vorfälle – ich habe selber einem ein Messer abgenommen, [an] das kann ich mich noch erinnern, weil der geglaubt hat, es hat sich einer vorgedrängt, nur wir haben eben dann dieses ‚Bebänderungssysstem’ gemacht, und da hat es dann funktioniert, dass die Leute gewusst haben, sie kommen rüber, wann kommen sie rüber, in wie vielen Stunden kommen sie rüber. Die haben einfach die Panik gehabt, dass sie nicht rechtzeitig – dass sie nicht rüber kommen über die Grenze. Da hat es dann Konflikte gegeben. Sonst hat es später Konflikte gegeben in der ASFINAG, im großen Camp, nur da hat es die Konflikte hauptsächlich gegeben mit, sage ich einmal, Leuten vom afrikanischen Kontinent, primär die Nordafrikaner, Westafrikaner, die sich dann dort schon eingerichtet haben, weil es längere Wartezeiten gegeben hat. Und dort hat es dann Schlägereien gegeben, Alkoholkonsum, den sie nicht vertragen haben – da haben wir dann auch mehrere des Camps verweisen müssen, und das ist soweit gegangen, Belästigung von Frauen – aber da haben wir gemeinsam mit dem Bundesheer etc. wirklich rigoros durchgegriffen, die haben das auch gewusst, genauso wie die Drogensachen, da gibt es nix.
HS: Stichwort ‚Bebänderung’ – wer hat’s erfunden?
MV: Wer hat’s erfunden? Die Idee war eine Zusammenarbeit vom Karl Müller und von mir. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwas finden, der Karl hatte dann diese Idee mit Bändern, und ich habe dann gleich einmal gewusst, wo wir solche Bänder herkriegen, das war relativ lustig, und ein paar Stunden später haben wir die Bänder gehabt, und die Leute waren total happy.
HS: Wo hast du sie her gehabt?
MV: Die ersten Bänder – ich habe ja nicht gewusst, wo man so etwas kriegt, auf die Schnelle – waren von der JVP, von irgendwelchen Festen, die die gemacht haben, und da war ‚JVP’ noch aufgedruckt. Da hat irgendwer gesagt „Das ist ja Parteiwerbung“, da habe ich gesagt „Das interessiert mich überhaupt nicht, besorg Bänder ohne Aufdruck, und ich mache keine Werbung – ich brauche Bänder“. Ja, aber es hat funktioniert [lacht].
HS: Habt ihr dann die Bänder offiziell bekommen von der Stadt, oder vom Land?
MV: Wir haben dann, über den Einsatzstab haben wir die Bänder dann wirklich im großen Stil gebraucht, [und] dort auch bestellt. Und wir haben immer wieder Leute gehabt am Anfang, die uns Geld da gelassen haben, Spenden – und da hat dann eine gesagt, „Du, ich weiß, bei der Firma gibt es solche Bänder“, [da] habe ich gesagt „Da hast du Geld, fahr hin“. Wir haben Gutscheine bekommen von manchen Leuten, die haben gesagt „Mike, was brauchen wir?“, da habe ich gesagt „Geht rüber zum Hofer, wir brauchen da jetzt ein bisschen Babynahrung“, in der Anfangsphase, „wir brauchen eine Babynahrung für was Kleines“. Und da haben wir dann die Möglichkeit gehabt, dass wir da ein bisschen was einkaufen auch, dass wir ein minimales Budget haben – aber genau für solche Sachen haben wir das auch gebraucht.
HS: Kannst du das System beschreiben – das war ja, glaube ich, farblich. Also farblich unterschiedliche Bänder und das Ausreisedatum, oder der Zeitpunkt angezeigt, nicht?
MV: Genau so ist es. Das waren unterschiedliche Farben, jeder Tag hat eine eigene Farbe gehabt, und dann haben wir gewusst, an welchem Tag man weiterkommt, entweder von der ASFINAG zur Grenze, und dann weiter über das Auslasszelt von der Grenze nach Freilassing hinüber, über diese kleine Wehr. Da haben sie das gemacht. Da sind sie zu Fuß hinübergegangen, die Flüchtlinge und sind dann dort von der deutschen Polizei in Empfang genommen worden, haben dann Leibesvisitation gehabt, Datenaufnahme, und sind dann weiter gebracht worden nach Freilassing in so ein kleines Auffanglager. Und das Wichtige war eben, jeder hat dann gewusst, anhand von der Nummer, die er oben gehabt hat, von dem Buchstaben, wann er drankommt. Wann er zum Bus kommt, dass er von der ASFINAG nach Freilassing, also zur Grenze, gefahren wird, und wann er dort weiterkommt. Und es war immer blockweise. Wir haben mit den deutschen Exekutivbeamten immer eine gewisse Zeit, ein gewisses Kontingent ausgemacht, in der Stunde lassen wir 60 Leute durch, das heißt, wir haben dann alle zehn Minuten sechs Leute, oder alle sechs Minuten zehn Leute durch gelassen und haben uns mit denen immer abgestimmt, dass eine gewisse Kontinuität da ist, weil wenn das stockt, dann waren die schon wieder nervös. Wenn da jetzt einmal zwei Stunden nichts gegangen ist, das hat sich herumgesprochen – und die waren ja sehr gut vernetzt. Die haben ja alles – also die von der ASFINAG haben gewusst, was in Freilassing ist, und die in Freilassing haben gewusst, was in Rosental in Kärnten abläuft, wo die ersten, wo die Züge hereingefahren sind. Die haben alles gewusst, die waren perfekt vernetzt über Social Media.
HS: Mhm. Ich kann nur berichten, es hat das Bändersystem enorm viel Druck rausgenommen.
MV: Ja. So ist es.
HS: Das war meine Beobachtung, weil auf einmal die Leute gewusst haben – also die Flüchtenden haben gewusst, wie das Ganze ablaufen wird, also deren Unsicherheit war weg.
MV: Ja. Das war weg. Der Druck war größtenteils heraußen. Wir mussten natürlich immer schauen, bei diesen Gruppen, die wir über die Grenze gelassen haben, dass wir auch – es sind ja auch Familien gewesen, mit zehn Leuten, also nicht so wie bei uns, Vater, Mutter, Kind, sondern diese Familien waren wirklich zehn Leute. Und dass die gemeinsam hinüber kommen, weil da war ja, hat es ja Panik gegeben, wenn du da irgendwie den Cousin dritten Grades, der auch die ganze Tour mit ihnen gemacht hast, nicht hinein gelassen hast. Jetzt haben wir da mit den Deutschen wieder hinübergefunkt und haben gesagt „Du, jetzt kommt eine Gruppe mit elf Leuten. Bei der nächsten Gruppe schicken wir dir aber nur neun Leute dafür, nur dass die Familie zusammenbleibt“. Und da war die Arbeit auch mit den deutschen Exekutivbeamten wirklich sehr gut. Man konnte mit denen reden. Wir haben denen wirklich gesagt „Ok, jetzt kommt eine größere Gruppe, weil das ist eine Familie“, und die haben gesagt „Ja, passt“. Und das hat gut funktioniert, es war auch wichtig, dass man ihnen den Druck herausnimmt. Ich meine, am Schluss haben sie es dann schon mitbekommen, dass, wenn sie in der Gruppe bleiben wollten, dass sie dann einfach gesagt haben „Family, Family“ – und wenn du dann ein bisschen nachgefragt hast, bist du draufgekommen, keine Family, sondern einfach eine Freundesgruppe, und da hast du dann gesagt „Ok, wenn sich’s ausgeht, geht sich’s aus, dann ist es gut, aber wenn einer von den Freunden jetzt bei der nächsten Gruppe mitgeht – ja, sie treffen sich eh im Lager, im nächsten, wieder“. Nur, sie haben es nicht gewusst, dass sie sich da treffen. Sie haben es ja nicht glauben können. Zu uns haben sie ein bisschen ein Vertrauen gehabt, weil wir gesagt haben „Ihr kommt zum Bahnhof, in die ASFINAG, von der ASFINAG kommt ihr nach Freilassing, und von Freilassing kommt ihr nach Deutschland“. Nur sie haben dann nicht gewusst, was passiert in Deutschland weiter. Aber im Großen und Ganzen hat das wirklich gut geklappt und viel, eben, wie du auch richtig gesagt hast, Druck herausgenommen. Weil die gewusst haben, jetzt bin ich bald dran.
HS: Deutsche Behörden, deutsche Seite – es hat auf der österreichischen Seite immer wieder so Stimmen gegeben, „Wir müssen Druck auf die Deutschen ausüben“ – möglicherweise auch dieser berühmte ‚Marsch’, der da stattgefunden hat – hast du das gemerkt? Oder wie war da deine Wahrnehmung?
MV: Ja, ich glaube schon, dass man ein bisschen versucht hat, auf die Deutschen Druck auszuüben – nur, ich glaube, die Deutschen haben nicht viel Druck ausüben lassen. Weil, ich weiß genau, wenn irgendwas nicht so gepasst hat, dann waren die Zahlen, wie wir die Leute hinüber bekommen, die waren dann einfach wieder geringer. Da haben wir dann halt in der Stunde nicht – nur als Beispiel – nicht 60 Leute hinüber bekommen, oder nicht 50 Leute hinüber bekommen, sondern nur 20, weil da haben sie sich wieder Zeit gelassen. Dadurch ist bei uns dann die Lage so gewesen, dass die Leute beunruhigt waren: „Warum kommen wir jetzt nicht hinüber?“. Die haben ja gewusst, in etwa so muss es laufen. „Warum kommen wir jetzt nicht hinüber?“ – Dann ist da schon ein bisschen eine Unruhe [gewesen], da haben wir gesagt „Nein, momentan, die machen gerade, die haben Schichtwechsel, oder die tauschen was aus, bla bla bla...“ – dann hat es eh wieder, dann haben wir sie wieder beruhigen können. Aber, ich glaube nicht, dass die so beeindruckt waren, die Deutschen. Weil die haben, wie gesagt, die sind am Hahn gesessen und haben gesagt „So viele lassen wir rein, so viele lassen wir nicht rein“.
HS: Naja, es hat diese, diesen einen Marsch gegeben, und – für mich interessant, wenn ich jetzt nachfrage, egal wen – jeder schiebt es weg von sich. Ich habe nämlich vermutet, es kam aus Wien, dort hat man mir gesagt, „Nein, auf keinen Fall“, also es kam nicht aus dem Innenministerium zum Beispiel, diese Überlegung – hast du eine Theorie, wer geglaubt hat, man könnte die Deutschen unter Druck setzen? Was ja, wie du richtig gesagt hast, was ja eine naive Vorstellung ist, oder war.
MV: Ich vermute einmal schon, dass das aus Wien kommt, ganz ehrlich. Weil bei uns kommt keiner drauf. Also ich glaube nicht, dass irgendwer vom Land, von der Stadt, von der Feuerwehr auf die Idee kommen würde, dass er sagt „Jetzt üben wir Druck aus, indem wir sie ihnen hinüberschicken“, das glaube ich nicht. Ich meine, wir haben relativ viel Druck herausgenommen, aber das war ja, glaube ich, nicht so bewusst. Wir haben ja mitbekommen, dass da diese Mengen von – ich weiß nicht, wie viele es waren, eineinhalb Tausend oder so was – vom Bahnhof Richtung Salzburg marschieren, Richtung Grenze marschieren, und es war helle Aufregung, ich habe gesagt „Ok, wir lassen sie aber nicht durch, die verwüsten uns das Lager, wenn da jetzt eineinhalb Tausend Leute durch marschieren, geht nicht“. Vorn hat die Polizei dicht gemacht, die deutsche, dann sind sie nicht hinüber gekommen, das heißt, die waren mehr oder minder in einer Sackgasse, in einem Kopfbahnhof. Und wir haben gesagt „ok“, ich habe gesagt „wir lassen niemanden rein, eben in Absprache mit dem Einsatzstab, und die ‚25er vom Bundesheer‘, also die haben das perfekt gemacht, weil wir haben dann dort auch alle, wirklich alle, bebändert, aufgenommen, wer wo ist, in gewisse Sektoren das Ganze eingeteilt, und auf einmal haben wir kein Problem gehabt, und die Leute haben – alles war geregelt. Und es war kein Chaos bei uns in Freilassing, an der Grenze, das war das Schöne. Natürlich war Aufruhr und alles, weil wir haben geglaubt, die rennen jetzt da durch. Nur, wir haben sie einfach nicht herein gelassen, und nur kleine Gruppen, immer wieder, immer wieder herein gelassen, und es hat funktioniert, es hat gut funktioniert. Und das war wirklich, muss ich sagen, das war die Tatkraft des Bundesheeres, die das gemacht hat. Weil mit denen haben wir uns zusammengeredet und haben gesagt „Wenn die alle herein stürmen, dann haben wir ein Problem. Das geht nicht. Wir müssen die in einen Trichter hinein[lotsen] und dann sukzessive, kleinweise [durch lassen] – [das hat] super funktioniert.
HS: [Das] Bundesheer, das waren ja zum Teil auch Rekruten, oder Wehrdiener.
MV: Nein, ganz, ganz wenige bei uns. Bei uns waren es die 25er, das sind Fallschirmjäger aus Kärnten, das weiß ich noch, und die waren super, die waren alle schon in Krisengebieten dort, also die, mit denen ich geredet habe, größtenteils. Für so Hilfs-Sachen hat es dann Rekruten gegeben, aber die, die das Sagen unten gehabt haben, das waren diese von den 25ern aus – irgendwas [in] Kärnten – und die waren wirklich super. Weil die haben gewusst, man muss – man darf nicht nur in die eine Richtung schauen, man muss auch mal dorthin schauen, und dorthin auch schauen. Wir müssen das hinkriegen, dass das funktioniert, und nicht nur tausendprozentig nach diesen Regeln, die sie da aufgestellt haben. Sondern die haben sich – ich vergleiche sie mit einem Gummiband, das kann man in jede Richtung ein bisschen dehnen. Und die sind immer so weit gegangen, bis es halt nicht reißt. Aber sie haben genau gewusst, wo sie hingehen können, dass es für die Sache gut ist, und dass es funktioniert. Und die waren wirklich – also, das hat auch jeder gesagt – die waren spitze. Weil wenn du die gebraucht hast, waren sie da.
HS: Das ist jetzt interessant, so klar habe ich das bis dato nicht gehört. Auch mit der Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe von Personen, sage ich jetzt einmal, in dem Fall Bundesheer. Wie hast denn du die anderen Behörden, Blaulichtorganisationen, gesehen, deren Einsatz, deren Zugangsweise?
MV: Ja, Rotes Kreuz hat dort die Versorgung gemacht eben für die Verletzten, das hat super funktioniert, genauso wie mit dem Arbeiter-Samariter-Bund. Die waren total engagiert, da war immer jemand da, da hat man auch immer irgendwie eine Ansprechperson gehabt, und da sind viele gekommen mit kleinen Verletzungen, mit Krankheiten dann, wie es in den Herbst hinein gegangen ist, dann mit Husten, Schnupfen, Kinder mit Bronchitis – das hat super funktioniert, das hat wirklich – und die haben sich auch gekümmert darum. Also auch beim Roten Kreuz habe ich gesagt „Ruft mich nachher an, wenn ihr den weg bringt, ich muss nur wissen, wo der ist, wo die Person liegt, weil die Familie dann die Panik hat, wenn sie nicht wissen, wo sie ist, wo sie sie erreichen können“. Weil, man muss sich vorstellen, aus dem Familienverbund wird jetzt die Mutter mit dem Kleinkind herausgerissen und kommt ins Krankenhaus, ist dort zwei, drei Tage, und der Rest der Familie muss aber noch da bleiben und weiß aber nicht, wo ist sie, was ist mit ihr passiert. Die haben ja eine Panik gehabt. Und das hat super funktioniert, ich habe die Informationen bekommen, die haben gesagt „Du, die ist auf der Kinderchirurgie mit dem Kind“ – „Passt, danke, wie lang wird sie bleiben?“ – „Du, das ist der Arzt, mit dem kannst du auch telefonieren“ – und das hat funktioniert, das hat wirklich gut funktioniert, diese Zusammenarbeit. Die haben auch gewusst, warum ich das wissen muss. Dass ich den Menschen sage „Du, die Mutter ist dort, zwei Tage, wenn sich etwas Neues ergibt, sage ich es euch“. Und dann beim Zurückholen habe ich auch gesagt „Ihr bringt mir die dort her und gebt sie bitte bei mir ab, oder bei demjenigen ab, weil der weiß Bescheid, dass die wieder zurückfindet zu ihrer Familie“.
HS: Wie hast du dich mit den Flüchtlingen verständigt, in welcher Sprache?
MV: Mit Händen, mit Füßen, ein bisschen Arabisch, was ich konnte und gelernt habe, Englisch natürlich viel, Dolmetscher – ohne Dolmetscher wäre nichts gegangen, also das war super, wir haben viele, viele gehabt, die selber Flüchtlinge waren, die in diesem Zug dabei waren, die aber dann geholfen haben. Die haben natürlich auch ein paar Vorteile gehabt, das stimmt schon, aber die haben mitgearbeitet, übersetzt für uns, Arbeiten gemacht – ohne die wäre es gar nicht gegangen. Einer zum Beispiel hat einen eigenen Dolmetscher-Pool aufgebaut, wo wir Dolmetscher bekommen haben – das war perfekt, also da haben wir wirklich das gehabt, was wir brauchen. Und es waren ja so viele unterschiedliche Sprachen, es war ja nicht nur Arabisch. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Sprachen – und der eine kommt aus der Gegend, ja, aber der spricht eine andere Sprache als der – ok, wir brauchen jemanden, der diese Sprache spricht. Und das hat alles funktioniert, das hat wirklich funktioniert. Wir haben uns dann alles auch organisiert, wir haben uns dann eigene Funkgeräte organisiert, dass wir in der ASFINAG, was ja relativ großräumig war – wie wir hinten gestanden sind [und gemerkt haben] „Wir brauchen einen Dolmetscher, weil da gibt es irgendeinen Wirbel“ – dann ist schon ein Dolmetscher gelaufen. Das haben wir über Funk dann denen gesagt, und da ist schon einer gekommen und hat dann übersetzt.
HS: Wo habt ihr euch das organisiert, oder hat euch das jemand gegeben?
MV: Nein, ich habe das bestellt und gekauft. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Budget gehabt, was Leute abgegeben haben, und da habe ich gesagt „Ok, wir brauchen was“, wir haben das auf Rechnungen gemacht, ich habe da damals so eine Art kleine Buchhaltung gemacht, alle Rechnungen zusammen, dass [man] gewusst hat, wofür ist das und was haben wir da gekauft. Also wenn jemand gefragt hat „Was habt ihr denn gekauft?“, sage ich „Schau her, das haben wir gekauft, und fertig“.
HS: Wie hast du die Infrastruktur generell erlebt, also Bahnhof, ASFINAG, Grenze?
MV: Welche Art der Infrastruktur meinst du?
HS: Naja, alles, also was Unterbringung betrifft...
MV: Super. Super, für die Zeit die man gehabt hat, für die Menge Leute, die da waren, waren die Ressourcen super. Ich meine, es waren ja lauter Sachen dabei, die für uns nicht so problematisch sind, für die aber schon. Wir haben geteilte Zelte gebraucht, Männer – Frauen. Wir haben mit Kindern, Frauen mit Kindern. Dann sind sie gekommen [und] haben gesagt „Ja, das ist mein Sohn“ – „Der gehört ins Männerzelt“ – „Ja warum, das ist mein Kind“ – [da] sage ich „Nein“. Und was für eine Regel, die haben dir ja nicht das wahre Alter gesagt, wir haben gar nicht sagen können, alle ab 12 kommen ins Männerzelt. Ich habe einfach dann gesagt, sage ich „Alle, die einen Bartansatz haben, sind im Männerzelt. Alle, die keinen Bartansatz haben, sind im Frauenzelt“ [lacht]. Weil wir das nicht vermischen wollten. Und es hat auch dann wirklich funktioniert. Und die Infrastruktur, wir haben Wasser, wir haben Wasser gehabt, wir haben Duschen gehabt, wir haben – am Bahnhof zum Beispiel, denke ich an die Ricky Veichtlbauer mit ihrem Team, dass sich die Leute waschen können, dass sich die Frauen waschen können, die haben eine ganz eigene Scham, da darfst du ja nichts sehen das war für alle tabu. Wir haben eigene Wasch-Container bekommen, nur für die Frauen. Dass das funktioniert. Das ist nicht so einfach wie bei uns, wo man sagt „Ok, am Campingplatz, du hast eine Dusche für Männer und eine für Frauen und die gehen nebeneinander hinein“, das hat es ja alles nicht gegeben, das hätte es auch nicht geben dürfen, da hätte sich ja keine gewaschen. Und das hat funktioniert, und es waren immer, immer waren so Teile eben dabei, wie das Team um die Ricky Veichtlbauer, die sich auf etwas spezialisiert haben, und da hat ihnen aber auch keiner dreingeredet. Die haben gesagt „Wir bräuchten das bitte, das wäre uns wichtig“, und das hat funktioniert. Die Kleiderspenden mit der Caritas, die waren für das zuständig, das heißt, es hat jeder ein bisschen seinen Bereich gehabt, wo wir gewusst haben, dort, wenn wir das brauchen, kriegen wir es dort, können wir dort anfragen, können wir da anfragen – und das war Goldes wert.
HS: Mhm. Das ist nämlich völlig richtig, die Beobachtung, es ist ja eine komplett andere Kultur, also die muslimische Kultur, jetzt, was du angeschnitten hast, das Schamgefühl und so weiter und so fort, das haben wir, glaube ich, alle in einem Schnellsiedekurs damals gelernt. Den Eindruck habe ich gehabt. Ich habe mich zum Beispiel zu diesem Dusch-Zelt nicht einmal hin bewegt, weil ich gewusst habe, ich darf nicht hin.
MV: Ja. Nein, ich auch nicht. Ich habe mich nicht einmal mit der Kamera in die Nähe bewegt, dass ich irgendein Foto gemacht hätte nur von dem Zelt, was da war, weil ich mir gedacht habe „Wenn dich dort einer sieht, da gibt es gleich einen Aufruhr. Das mache ich nicht, fertig“.
HS: Gut, schauen wir in die Zukunft. Glaubst du, dass Ähnliches wieder passieren kann, also noch einmal so ein Ansturm – die Zahlen nochmal, 350.000 innerhalb von drei, dreieinhalb Monaten allein in der Stadt Salzburg, 900.000 in Österreich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe.
MV: Ja, glaube ich schon, dass so was wieder passieren kann.
HS: Warum?
MV: Warum? Wenn das Leid und die Angst in deren Heimatländern zu groß wird, dann riskieren sie das einfach. Und [denkt nach] ich glaube nicht, dass sich die Leute, die dort unten dieses Leid erfahren – in Kriegsgebieten, sage ich jetzt, ich mache das nicht auf die Wirtschaftsflüchtlinge – dass sich die von ein paar Grenzbalken da irgendwie nur im Geringsten davon abhalten lassen werden.
HS: Das heißt, diese oft zitierte ‚Festung Europa’, die Zäune etc. – die Türchen mit Seitenteilen.
MV: Nein. Wenn jemand durchkommen will, dann kommt er durch. Und wenn jemand durchkommen – das ist das Gleiche, was wir jetzt haben mit unseren Grenzkontrollen. Die wissen alle, dass es am Walserberg Grenzkontrollen gibt. Aber in Großgmain gibt es keine, und am Dürrnberg gibt es keine, und in Oberndorf gibt es keine. Nein, Entschuldigung – wenn du Nichtschwimmer bist, wirst du den Weg übers Wasser wählen? Wenn du weißt, da ist ein Strudel, da ersäufst du? Nein. Dann gehst du über die Brücke drüber und hast kein Problem. Und genau so werden es die auch machen.
HS: Ja, das sehe ich auch so. Ja, dein persönliches Resümee?
MV: Mein persönliches Resümee. Ich hätte mir nie gedacht, dass die Zusammenarbeit von so unterschiedlichen Menschen und Organisationen in einem Notfall so gut funktionieren kann und so gut funktioniert, dass man alle an einem Strang zieht, um wirklich zu helfen. Ich habe extrem viele Freunde gewonnen – nicht nur jetzt auch bei den Flüchtlingen, sondern auch bei den Einsatzorganisationen – wo ich mich jedes Mal wieder freue, wenn ich die treffe, irgendwo, weil wir alle an einem Strang gezogen haben und weil alle dasselbe Ziel gehabt haben. Dafür da zu sein, dass wir dieses Problem jetzt lösen. Und das war für mich wirklich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
HS: Wunderbar, danke.
Transkript erstellt von Katharina Steinhauser

